
Begonnen hat es mit Kleinigkeiten: Zu Hause entdeckte Katrin Seyfert immer häufiger kleine Zettelchen, auf denen sich ihr Mann die selbstverständlichsten Dinge notiert hatte: "Fußballtraining 16 Uhr", "Brot kaufen". Dann kam ihr Geburtstag – er hatte ihn vergessen. Und es folgten Vorwürfe: Warum hast du kein Brot gekauft, den Müll nicht weggebracht, meinen Geburtstag vergessen?
Durch die Masse an Kleinigkeiten war Seyfert und ihrem Partner Marc schnell klar: Das ist Alzheimer. Bei der offiziellen Diagnose ist Seyfert 46, ihr Mann gerade einmal 52. Fünf Jahre lang begleitet sie ihren Mann, den Vater ihrer drei Kinder, durch die Erkrankung. Sie organisiert den Familienalltag, die Finanzen, die Pflege und schließlich die Beerdigung. In ihrem eben erschienenen Buch "Lückenleben" schreibt sie schonungslos offen darüber, wie es ist, wenn der Partner allmählich seine Identität verliert. "Aber es ist kein Buch über Alzheimer", sagt sie. Vielmehr geht es um den Kampf gegen gesellschaftliche Konventionen – und darum, wie sie sich mit der Lücke, die ihr Mann hinterlassen hat, arrangiert.
STANDARD: Als sie die ersten Anzeichen bemerkt haben, wussten Sie tief im Innersten schon, dass es Alzheimer sein würde, schreiben Sie. Sie wollten es nur lange nicht wahrhaben, oder?
Seyfert: Na ja, es hätte ja auch eine Depression sein können. Aber mit der Zeit schließt man immer mehr Möglichkeiten aus. Und schließlich sind wir zu einer Gedächtnissprechstunde gegangen. Die Ärztin sagte dann noch zu mir: "Ach, Ihr Mann ist so fit, das ist kein Alzheimer. Aber wir machen zur Sicherheit trotzdem eine Untersuchung." Und im Nervenwasser hat man dann die Taurin-Anreicherung gesehen.
STANDARD: Ihr Mann war Arzt, kannte also auch das Krankheitsbild der Demenz sicherlich in der Theorie sehr gut. Glauben Sie, er hatte mit der Diagnose gerechnet?
Seyfert: Auf jeden Fall! Marc war Internist und hatte auch Ahnung von neurologischen Erkrankungen. Er wusste über jeden Quadratzentimeter seiner Krankheit Bescheid. Etwa eineinhalb Jahre vor der Diagnose hatten wir einen Streit, weil ich sagte, er soll sich endlich untersuchen lassen. Er ging dann zu allen erdenklichen Ärztinnen und Ärzten, die aber keine Alzheimer-Diagnosen stellten. Er machte ein Lungenröntgen, ließ seine Füße und den Magen-Darm-Trakt untersuchen.
STANDARD: Trotzdem begreift man das wohl erst so richtig, wenn man die Diagnose hat. Was hat die Diagnose verändert, auch wenn man es insgeheim schon wusste, dass es wohl eine Demenz ist?
Seyfert: Die krasseste, unmittelbare Konsequenz war, dass er schon am nächsten Tag nicht mehr als Arzt weiterarbeiten konnte. Das ist ja verständlich, es will sich wohl niemand gerne von einem Arzt mit Demenz behandeln lassen. Das hat auch versicherungstechnische Gründe. Wir hatten das große Glück, dass da vor der Diagnose noch keine Kunstfehler passiert waren.
STANDARD: Und was hat sich auf emotionaler Ebene für Sie verändert?
Seyfert: Wenn man die Diagnose erst einmal hat, entkommt man ihr nicht mehr. Irgendwann kommt dann halt die Akzeptanz, weil sie eben kommen muss. Ich kann mich ehrlich gesagt gar nicht mehr erinnern, wie dieser Prozess genau war …
STANDARD: Sie meinen, die Erinnerungen an diese intensive Zeit sind etwas schwammig?
Seyfert: Ja. Ich mag das Wort "schwammig" nicht, aber der Zustand, den es beschreibt, stimmt. Ich musste zu der Zeit so wahnsinnig viel klären, verarbeiten und organisieren, dass gar keine Zeit zum Verzweifeln blieb. Das Gedankenkarussell lief auf Höchstgeschwindigkeit. Bei den Kindern steht das Lernentwicklungsgespräch an, der Hund braucht Futter, ein Arztbesuch gehört organisiert, die Buntwäsche gemacht, und, und, und.
STANDARD: Wie hat Ihr Mann die Diagnose aufgenommen?
Seyfert: Sehr stoisch. Gleich zu Beginn, als er die Diagnose bekommen hat, hat er einmal gesagt: "Wenn das mein Schicksal sein soll, bin ich bereit, das zu ertragen." Und genau das hat er gemacht, da gab es nicht viel Selbstmitleid. Eher im Gegenteil, am Ende hat er uns noch einen großen Brocken zum Lernen mitgegeben. Obwohl er der Kranke war, der auf unsere Hilfe angewiesen war, hat er uns noch was über das Leben beigebracht. Absurderweise war er am Ende wie ein Heiler für mich und meine Kinder, das hätte ich mir vorher niemals so gedacht.
STANDARD: Trotzdem war die Trauer in dieser intensiven Zeit natürlich groß. Sie schreiben davon, wie sehr es schmerzt, um jemanden zu trauern, bevor er stirbt. Sie haben sich jeden Tag ein bisschen mehr von ihm verabschieden müssen. Haben Sie über den Schmerz mit ihm gesprochen?
Seyfert: Ich glaube, er wusste bis zum allerletzten Tag, wie's mir damit ging. Es gab oft genug Situationen, wo er mich einfach tröstend in den Arm genommen hat und ich genau wusste, was er mir jetzt alles sagen würde, wenn er noch eine Sprache hätte. Er hat es dann halt mit einer Umarmung getan.
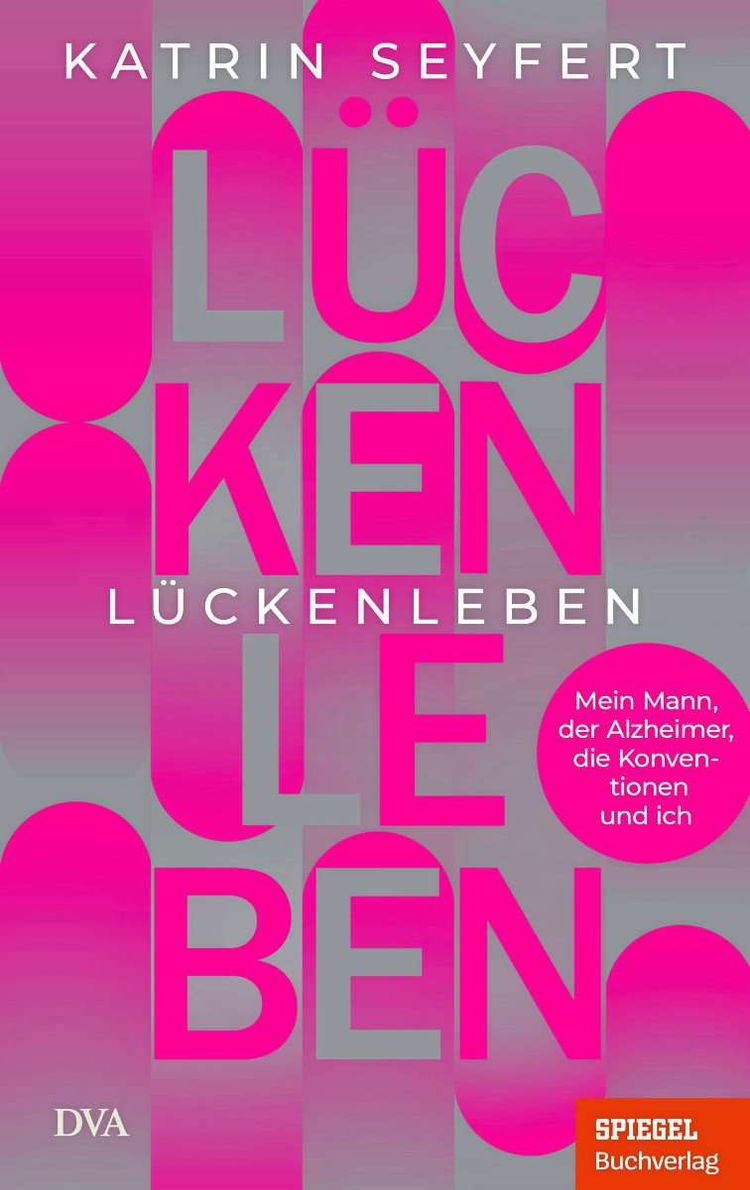
STANDARD: In den vergangenen Jahren hatten Sie viele Rollen. Die liebende Partnerin, die Pflegerin, jetzt die Witwe …
Seyfert: … und jede Rolle fordert andere Konventionen ein. Wahrscheinlich bin ich als Witwe am schlechtesten, weil einem vieles abgesprochen wird. Als pflegende Angehörige durfte ich noch viel mehr verrückte Ideen haben.
STANDARD: Was meinen Sie damit?
Seyfert: Wir haben etwa regelmäßig einen Musikabend für Marc organisiert. Und wir haben mit all den Stöcken, die er aus dem Wald mit nach Hause gebracht hat, eine Ausstellung gemacht. Wir wollten, dass er sich als der Künstler, der er war, nochmal lebendig fühlt.
Kurz vor seinem Tod kam er einmal im Garten auf mich zu und verkündete lauthals: "Katrin, Katrin! Wir haben im Lotto gewonnen! Du hast jetzt keine Sorgen mehr!" Wir haben nie Lotto gespielt, trotzdem habe ich mich überschwänglich mit ihm gefreut. Auch die Kinder haben direkt perfekt mitgespielt, die meinten: "Ach echt, Papa? Das ist ja Wahnsinn!" Wir haben dann rasch einen riesengroßen, möglichst echt aussehenden Scheck gebastelt und ihm am nächsten Abend überreicht. Einfach, weil ich dachte, dass vielleicht ein kleines Stückchen von diesem Theater noch bei ihm ankommt und er sich keine Sorgen machen muss. Deswegen war das für mich überhaupt keine zynische Patientenverarsche, sondern ich wollte, dass er sorglos ist.
STANDARD: Wie haben Ihre Kinder emotional diese Krankheitsgeschichte durchlebt?
Seyfert: Sie sind sehr unterschiedlich damit umgegangen. Unser ältester Sohn hat mit 15 ein Buch geschrieben. Den Titel "Vom Privileg, einen kranken Vater zu haben" hat er sich selbst ausgedacht. Der zweite Sohn war eher schweigsam und hat vieles mit sich und unserem Hund ausgemacht. Die dritte, das Mädchen, war sehr sozial und hat viel geredet.
STANDARD: Sie sind Journalistin und haben nicht nur jetzt ein Buch über diese intensive Phase geschrieben, sondern auch schon währenddessen immer wieder in Artikeln über Ihre Situation publiziert. Warum?
Seyfert: Ich habe immer geschrieben, mein ganzes Leben lang schon. Und eigentlich ist es nur folgerichtig, dass ich die größte Geschichte meines Lebens auch aufschreibe.
STANDARD: Hat Ihr Mann das noch mitbekommen? War er einverstanden?
Seyfert: Ja, das hat er schon noch sehr bewusst wahrgenommen. Den ersten Artikel hat er, so, wie wir das davor auch immer gemacht haben, sogar noch Korrektur gelesen.
STANDARD: Sie betonen in Ihren Texten immer wieder und auch im Buch gleich zu Beginn, dass Marc die Liebe Ihres Lebens ist. Wie hat sich die Liebe durch die Krankheit verändert?
Seyfert: Das hat Inge Jens mal sehr schön in ihrem Buch über Walter Jens, der ja ebenso an Demenz erkrankt war, geschrieben. Sie meinte, dass sie sich natürlich nicht in den Mann der letzten Jahre verliebt hätte. Das Intellektuelle und Sprachliche war auch für mich eine wichtige Basis beim Kennenlernen, und das fiel weg. Trotzdem war die Liebe auch in der Krankheit immer noch da.
STANDARD: Wie?
Seyfert: In der Gewissheit, dass ich mich niemals von ihm trennen würde in diesen Jahren. Dass ich ihn hinüberbegleiten würde, so, wie wir das viele Jahre zuvor schon oft besprochen hatten. Es war meine Einlösung von dem dummen Satz "In guten wie in schlechten Zeiten".
STANDARD: Welchen Erwartungsdruck haben Sie in der Krankheitsphase und nach Marcs Tod gespürt?
Seyfert: Als pflegende Angehörige und Witwe darf man still und überfordert leiden und sich eine Zeitlang nur schwarz kleiden. Man darf verzweifelt sein, aber nicht wütend. Aber ich bin nun mal wütend und kreativ, darüber habe ich mich als Journalistin immer definiert. In meinen Texten steckt immer viel Wut. Auch in das Buch ist viel Wut geflossen. Nicht gegen meinen Mann, sondern gegen die Krankheit und die Konventionen.
STANDARD: Das stimmt, gesellschaftlich gibt es ein sehr klares Bild davon, wie eine Witwe zu sein hat. Mit welchen Zuschreibungen würden Sie sich denn wohler fühlen?
Seyfert: Ich bin eine Frau, die ihre drei Kinder wirtschaftlich versorgen kann und immer noch sehr lebendig durchs Leben geht. Und ich bin keine, die sich mit den großen Fragen wie "Warum ist mir das passiert?" aufhält. Einfach, weil das überhaupt nichts bringt. Das ist voller Hirnfick.
STANDARD: Stattdessen wollen Sie hinterlassene Lücken mit Leben füllen, sagen Sie. Wie gehen Sie heute mit dem Verlust um?
Seyfert: Ich werde nie aufhören, über meinen Mann zu sprechen. Meine Kinder und ich versuchen, ihn als Erinnerung in unser Leben zu integrieren. Aber wir verherrlichen ihn auch nicht. Also ich finde seine Neigung zu schlechtem Schlager oder seinen schrecklichen Hemdengeschmack darf man schon auch mal erwähnen. (Interview: Magdalena Pötsch, 23.4.3024)